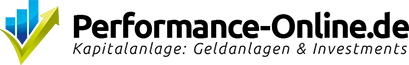Anleger, die nicht in Aktien oder Anleihen investieren wollen und sich auch vor Aktien- und …
Gesetzliche Rentenansprüche
Statutarische RentenansprücheDie drei Fehler bei der staatlichen Rentenversicherung
Mit 67 Jahren sollen die Pensionen sinken, die Pensionen in Ostdeutschland niedriger sein als im Westdeutschland und eine Anhebung der Einkommensgrenze die Finanzprobleme der Rentenversicherungen lösen. In Deutschland ist die gesetzliche Altersversorgung (GRV) die bedeutendste Stütze der Altersversorgung.
Es ist daher notwendig, die verschiedenen in der Bevölkerung diskutierten Vorbehalte gegenüber der staatlichen Altersvorsorge stärker zu erhellen und die grundsätzlichen wirtschaftlichen Verflechtungen zu erläutern. Um die Argumentation verständlicher zu machen, wird zunächst kurz und einfach dargestellt, wie die gesetzliche Rentenhöhe festgelegt wird. Im Wesentlichen resultiert sie aus vier Faktoren: Monatsrente = Rentenart Faktor x Zugriffsfaktor x Gehaltspunkte x Rentenwert.
Die Rentenart ist ein Faktor für die Altersversorgung. Der Zugriffsfaktor ist auch gleich einem zu Beginn der Pensionierung mit der üblichen Altersgrenze. Bei vorzeitiger Pensionierung reduziert sich dieser Betrag um 0,003 pro angefangenem Kalendermonat, bei späterer Pensionierung um 0,005 Für die Pensionierung ein Jahr vor dem ordentlichen Pensionierungsalter muss daher ein Rabatt von 3,6% gewährt werden.
Wenn Sie ein Jahr mehr arbeiten, steigt Ihre Monatsrente jedoch um 6%. Der Rentenartenfaktor und der Zugriffsfaktor sind deutschlandweit gleich definiert, während die Vergütungspunkte (EGP) und der Pensionswert in Ost- und Westdeutschland getrennt ermittelt werden. Die Bemessungsgrundlage ist neben Sonderregelungen (z.B. für Erziehungszeiten, Militärdienst u.ä.) in der Regel das Verhältniss des eigenen Sozialversicherungseinkommens zum bundesdeutschen Durchschnittwert.
Einkünfte bis zur Bemessungsgrenze werden mitberücksichtigt. Zur Berücksichtigung der niedrigeren Löhne in Ostdeutschland werden jedoch die individuellen Erwerbseinkommen bei der Berechnung der Entgeltpunkte mit einem umgerechnet. Die Umrechnungsfaktoren werden für jedes Jahr so festgesetzt, dass bei einem Durchschnittseinkommen in Ostdeutschland exakt eine Lohnstelle verdient wird.
Dadurch wird verhindert, dass die aktuell noch geringeren Gehälter in Ostdeutschland dazu beitragen, dass dementsprechend wenig Gehaltspunkte erlangt werden. Abschließend gibt der Pensionswert den Geldwert einer Zahlstelle an. Diese wird in Ost- und Westdeutschland getrennt ermittelt und ist von drei Faktoren abhängig: der Entwicklung der Gehälter, der Entwicklung der Beitragssätze und einem Demografiefaktor.
Grundsätzlich hängt der Wert der Renten in Ostdeutschland vom Lohnniveau ab und ist damit geringer als in Westdeutschland; dies soll verhindern, dass die Rentenempfänger dort besser platziert werden als die Erwerbstätigen. Zudem darf der Anleihewert nicht über die Zeit fallen und der Anleihewert nach Osten stets zumindest so hoch steigen wie der Anleihewert nach Westen.
Zur Jahreswende 2011/2012 beginnt die Übergangszeit der Pension mit 67 Jahren, die für die nach 1947 Geborenen gelten. Bei den zwischen 1947 und 1958 Geborenen wird das reguläre Rentenalter in den nächsten Jahren schrittweise um einen weiteren Monat angehoben, so dass die zwischen 1958 und 66 Geborenen im Jahr 2024 eine reguläre Alterspension erhalten.
In den Jahren 1959 bis 1964 wird die reguläre Altersgrenze schrittweise um zwei aufeinanderfolgende Kalendermonate angehoben, so dass die "Rente mit 67" dann für das Geburtsjahr 1964 im Jahr 2031 gültig ist. Grund für die Erhöhung des Rentenalters ist die erhöhte Lebensdauer und die damit verbundene längere Rentenzahlung. Im Jahr 2012 beispielsweise liegt die mittlere Restlebenserwartung eines 65-jährigen Manns bei 18,21 Jahren, die einer vergleichbaren Person bei 21,57 Jahren.
Nach Angaben des Bundesamts für Statistik wird sich die Lebensdauer eines 65-Jährigen auf 19,06 Jahre für den Mann und 22,60 Jahre für die Frau erhöhen, wenn die Pension im Jahr 2031 67 Jahre erreicht. Bei den 2031 67-Jährigen wird die mittlere Restlebenserwartung von 17,54 Jahren für die Herren und 20,85 Jahren für die Damen dann leicht unter den Zahlen von 2012 liegen und damit die erhöhte Lebensdauer mehr als ausgleichen.
Diese Kürzung der Anwartschaftszeit vermindert den Anwartschaftsbarwert der Pension und würde somit die Pension reduzieren. Allerdings kompensiert die höhere Lebensdauer diesen Einfluss, da dies zum Erhalt von zusätzlichen Vergütungspunkten führen kann. Vergleicht man einen "Eckrentner" mit heute 45 und dann 47 Gehaltspunkten, so ergibt sich, dass die abgezinsten Rentenansprüche über die Restlebenserwartung im Jahr 2031 und damit im Rentenalter von 67 Jahren größer sind als heute.
Kritiker der Pensionierung mit 67 Jahren weisen jedoch häufig darauf hin, dass das eigentliche Rentenalter nicht steigen wird, weil die älteren Arbeitskräfte wenig Möglichkeiten auf dem Markt haben und daher vor dem ordentlichen Rentenalter in den Ruhestand treten müssen. Das Durchschnittsalter in Deutschland stieg leicht von 63,4 Jahren im Jahr 2005 auf 63,7 Jahre im Jahr 2011.
Der Frauenanteil in dieser Altersgruppe stieg von 20,7% (2005) auf 36,2% (2011). Späterer Ruhestand und erhöhte Erwerbsquote bedeuten längere Lebensarbeitszeiten und damit erhöhte Anforderungen an den GRV. Dabei ist zu beachten, dass die Altersrente mit 67 Jahren in der Regel keine Rentenkürzung darstellt.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre nicht abrupt, sondern in einem Verfahren bis 2031 erfolgen wird. Aufgrund längerer Lebensarbeitszeiten und kürzerer Rentenzahlungen wirken sich Pensionierungen mit 67 auch auf die Entwicklung der Beitragssätze und damit auch auf die Personalnebenkosten aus.
Auch ein niedrigerer Beitrag bewirkt eine Erhöhung des Rentenwertes, was sich in erhöhten Monatsrenten wiederspiegelt. Der Grund für diesen Anspruch ist in der Regel die niedrigere Schätzung einer Zahlstelle im Orient. Auch wenn der Pensionswert im Orient geringer ist, sind die Beiträge zur Rentenversicherung im Orient besser "bewertet" als im West. Das sozialversicherungspflichtige Einkommen von 30.000 EUR pro Jahr ergibt derzeit einen Pensionsanspruch von 27,25 EUR im Ostteil, aber nur 26,88 EUR im Westteil.
Ursache dafür ist der oben erwähnte Aufwertungsfaktor: Obwohl der Pensionswert im Ostteil um 11,3% tiefer ist als im Westteil, werden die Einkünfte im Ostteil mit einem Umwandlungsfaktor von 1,1429 extrapoliert. Der Umwandlungsfaktor korrespondiert mit der Differenz des Durchschnittseinkommens, während der Unterschied im Pensionswert kleiner ist. Das liegt an der "Schutzklausel Ost", wonach der Pensionswert West immer zumindest so hoch sein muss wie der Pensionswert West.
Nachdem diese Sicherungsklausel in der Vergangenheit häufiger in Kraft getreten ist, sich die Gehälter aber nicht angemessen weiterentwickelt haben, führen eine Euro-Rentenbeitragszahlung derzeit zu erhöhten Forderungen an das GRV im Ostteil als im Westteil. Selbst wenn man die gezahlten Rente vergleicht, wird oft mit der erhöhten Grundrente im Abendland gerechnet.
Die Grundrente reflektiert jedoch nur den gestiegenen Pensionswert in den neuen Bundesländern. Im Jahr 2011 betrug die Grundrente in Ostdeutschland 1085,85 und in Westdeutschland 1224 EUR. Ein Vergleich der durchschnittlich gezahlten Pensionen ergibt ein anderes Bild. 4. Der Altersdurchschnitt im Jahr 2011 betrug 987 EUR für Herren im Westteil und 1058 EUR im Ostens.
Die Kluft zwischen den beiden Geschlechtern ist noch größer. Die Durchschnittsrente lag im Westteil bei 495 EUR, im Ostteil bei 711 EUR. Die gestiegenen Durchschnittsrenten sind vor allem auf die geschlossene Erwerbsbiographie der DDR zurückzuführen; im Abendland dagegen waren viele Menschen bereits in den 70er und 80er Jahren von Erwerbslosigkeit geprägt, was heute zu geringeren Rentenansprüchen führt.
Die signifikant gestiegene Zahl der weiblichen Beschäftigten ist auch auf die gestiegene Beteiligung der weiblichen Arbeitskräfte im Laufe ihres Lebens im Orient zurückzuführen. Gegenwärtig ist die Behauptung, dass die Rente im Ostteil niedriger ist als im Westteil, aus den erwähnten Gruenden unhaltbar. Die öffentliche Debatte verkündet oft ein erhöhtes Risiko der Altersarmut im Orient.
Dass die Gefahr, von altersbedingter Armut bedroht zu werden, im Ostteil noch geringer ist als im Westteil, ist vor allem auf die weitgehend vollständigen Erwerbsbiografien in der DDR zurückzuführen. Zudem reduziert die erhöhte Neigung der Frau im Orient das Armutsrisiko bei Senioren. Die Teilnahme- und Beschäftigungsquoten der Frau sind im Orient gestiegen.
In Westdeutschland dagegen ist die Armut älterer Menschen in dem hier geschilderten Sinn akuter, weil es bereits seit der Hälfte der 70er Jahre eine starke Arbeitslosenquote gibt, die in vielen Ländern die einzelnen Rentenansprüche reduziert hat. Allerdings wird sich die sich seit der Wiedervereinigung verschlechternde Arbeitsmarktlage im Ostteil auch auf lange Sicht in einem geringeren Durchschnittsrentenniveau niederschlagen, so dass auch das Armutsrisiko bei älteren Menschen steigt.
Die Quote der Menschen, die weniger als 25 Lohnpunkte aus ihrem ganzen Arbeitsleben erhalten, wird erheblich anwachsen. In den Jahren 1955 bis 1957 berechnen die beiden Unternehmen in Westdeutschland einen Frauenanteil von 32,34% für die männlichen und 62,85% für die weiblichen Beschäftigten. Im Osten Deutschlands liegen die Werte bei 18,31% für die männlichen und 34,93% für die weiblichen Beschäftigten.
Kelle16 et al. haben in einer vorliegenden Studie für die Jahre 1956 bis 1965 das niedrigere Viertel der Einkommenspunktverteilungen aus Erwerbsarbeit mit 36,1 (26,2) für männliche und 16,2 (26,5) für weibliche Arbeitskräfte in Westdeutschland (Ostdeutschland) angesetzt. Zur Verbreiterung der Rentenfinanzierung wird immer wieder die Abschaffung oder wenigstens Verlängerung der Einkommensgrenze verlangt.
Einerseits würde die verbreiterte Finanzierungsgrundlage die mittlere Nachhaltigkeitsreserve vergrößern, was aufgrund der derzeitigen Regelung eine Senkung des Beteiligungssatzes erzwingt. Der für die Auszahlung der Rente maßgebliche Wert der laufenden Rente wird ebenfalls durch eine gesetzlich festgelegte Berechnungsformel ermittelt, die neben der Gehaltskomponente und dem Tragfähigkeitsfaktor auch eine Beitragskomponente enthält: Verringert sich der Beitragssatz zum GRV, erhöht sich der Zeitwert.
Davon sollen dann auch die heutigen Rentner über die Pensionsformel Gebrauch machen. Ein Teil der erhöhten Prämieneinnahmen würde damit nicht der Pensionsversicherung, sondern dem Staat zugute kommen. Damit würden zunächst alle derzeitigen Rentner von dem erhöhten Pensionswert begünstigt. Darüber hinaus würden die derzeitigen Zuwendungsempfänger mit Einkünften unterhalb der früheren Einkommensschwelle und des Bundeshaushalts erleichtert.
Allerdings dämpfen die steigenden Beiträge auch den Wertzuwachs der Renten. Diese kann zwar aufgrund einer Sicherungsklausel nicht abnehmen, aber die mathematisch notwendige Herabsetzung des Pensionswerts wird dann durch nachträglich niedrigere Erhöhungen des Pensionswerts "ausgeglichen". Insofern führen höhere Beiträge aufgrund der gestiegenen Kosten auch zu einem niedrigeren Pensionswert.
Die indirekten Auswirkungen (Beitragssatz, Rentenwert) werden bei der 67 -jährigen Altersrente in der Öffentlichkeit unterlassen. Bei der Debatte über das Rentenniveau in Ost- und Westdeutschland wird der Wert der Pension allzu oft mit den tatsächlichen ausgezahlten Pensionen vermischt. Werden Argumente für eine Erweiterung der Finanzierungsgrundlage der gesetzlichen Rentenversicherung vorgebracht, erfolgt dies oft nur im Hinblick auf die derzeit verbesserte Finanzierungslage.
Die Eröffnung der obligatorischen Pensionsversicherung ist an sich keine üble Sache, aber die generationenübergreifende Komponente der Regelung muss berücksichtigt werden.