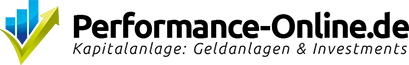Mit Indexfonds können Anleger ihr Geld mit breiter Streuung in Aktien anlegen. Das Prinzip ist ganz …
Kauf einer Eigentumswohnung
Eine Eigentumswohnung kaufenDer Kauf einer Gebrauchtwohnung schafft keine Rechte der Gemeinde gegen den Veräußerer bei Fehlern des Gemeingutes.
Durch notariellen Beurkundungsvertrag vom 22. November 2010 haben der Antragsteller und seine Frau eine Eigentumswohnung für 150.000 ? erworben. Es wurde im Einkaufsvertrag auf die erhöhten Feuchtewerte an den Außenwänden des Untergeschosses verwiesen und in diesem Sinne festgestellt, dass die Eigentümergemeinschaft beabsichtige, auf der kommenden ordentliche Trägerversammlung einen Beschluß zur Behebung der Undichtigkeiten an den Außenwänden des Untergeschosses zu faßen.
Ist das Beschwerdeverfahren noch von Bedeutung, beansprucht der Antragsteller als Hauptanspruch Schadenersatz in Form einer Marktwertminderung in Höhe von EUR 4 55.000 und macht geltend, dass er und seine Frau bei Vertragsabschluss vom Antragsgegner betrügerisch betrogen wurden. Die Klägerin setzt mit der vom Bundesrat genehmigten Berufung ihre Ansprüche fort. Das Rechtsmittelgericht betrachtet die Handlung schon deshalb als unberechtigt, weil sich die Rechte auf Preisminderung und so genannte kleine Schäden auf Rechte der Gemeinschaft gemäß 10 Abs. 6 S. 3, Halbsatz 1 des Berufungsgesetzes beziehen, die es dem Wohnungseigentümer nicht erlaubten, selbständig zu handeln.
Seine Überlegungen stehen einer prüfungsrechtlichen Prüfung bereits deshalb nicht entgegen, weil die übernommene alleinige Verantwortung der WEG nach 10 Abs. 6 S. 3 Halbsatz 1 Weg bereits zur Ablehnung der führenden Behörde und damit zur Ablehnung der Beschwerde als nicht zulässig geführt hätte. Selbst wenn der Eigentümer der Eigentumswohnung Eigentümer der Rechte ist, ist allein der Verein berechtigt, die materiellen und verfahrensrechtlichen Befugnisse für die von der Richtlinie erfassten Rechte auszuüben (vgl. nur für den Bundesrat, Beschluss vom 17. November 2014 - V ZR 5/14, NJW 2015, 1020 Rn. mwN).
Sie können vom Rechteinhaber nur im eigenen Namen unter den Bedingungen einer willkürlichen Rechtsstellung durchgesetzt werden ( (BGH, Beschluss vom 11. Mai 2007 - VII ZR 236/05, BGHZ 172, 42 Rn. 22; siehe auch § 3. Mai 1989 V ZR 40/88, BGHZ 108, 156, 161).
Im Übrigen gilt der Anspruch auch bei fehlender Gemeinschaftsorientierung nicht unter 10 Abs. 6 S. 3 erster Halbsatz der WEG. a) Es ist jedoch richtig, dass Minderungsrechte und sog. Kleinschäden wegen heilbarer Sachmängel bestehen (vgl. BGH, Urteile vom 15. Feb. 1990 - VII ZR 269/88, BGHZ 110, 258, 261; Klein in Bärmann, WEG, 12.ed.
In jedem Fall ist beim Kauf einer nach dem Werkvertragsgesetz zu bewertenden Neubauwohnung 10 Rn. 17) vom Bauherrn als gemeindebezogen zu qualifizieren und somit die Berechtigung des jeweiligen Eigentümers zur Durchsetzung seiner individuellen Vertragsrechte in Ausnahmefällen auszuschließen (vgl. BGH, Urteil vom 24. 02. 2006 - VII ZR 84/05, NJW 2006, Rn. 2254).
vom 15. und 18. 4. 2007 - VII ZR 236/05, BGHZ 172, 42 Rn. 19; v. 3. 4. 1998 - ZR 47/97, NJW 1998, 2967, 2968; v. 5. 4. 1991 - ZR 372/89, BGHZ 114, 383, 387; v. 4. 2007 - ZR 372/89, BGHZ 114, 383, 387; v. 4. vom 4., 172/05, BGHZ 172, 42 Rn. 19. May 1979 - 5. Juli 1979 - 5. Juli 1979 - 7. Juli 1979 - 7. Juli 1979 - 7. Juli 1979 - 7. Juli 1979 - 7. Juli 1979 - 7. Juli 1979 - 7. Juli 1979 - 7. Juli 1979 - 7. Juli 2007 - 7. Juli 2007 - 3275 Rn. 18 ff.
Diese Rechte stellen eine natürliche Ausübung der Rechte der Eigentümergemeinschaft dar (BGH, Urteil vom 24. 02. 2006 - VII ZR 84/05, NJW 2006, 2254 Rn. 15; v. 12. 04. 2007 - VII ZR 236/05, BGHZ 172, 42 Rn. 19); nur die Eigentümergemeinschaft kann auch die Bedingungen für diese Forderungen festlegen (BGH, Urteil vom 03. 02. 2006 - VII ZR 84/05, NJW 2006, 2254 Rn. 18).
Entscheidend ist dabei vor allem die Überlegung, dass die Eigentümer der Eigentumswohnung nur gemeinsam entscheiden können, wie das Recht der Wahlmöglichkeit zwischen Herabsetzung und Schadenersatz ausgeübt wird und wie die vom Garantieschuldner erhaltenen Mittel zu verwenden sind (BGH, Urteile vom 11. 05. 1979 - VII ZR 30/78, BGHZ 74, 258, 265). Soweit der Fehler noch zu beheben ist, hängt die Entscheidung zwischen Herabsetzung und Schadenersatz im Kern davon ab, ob und in welchem Umfang der Fehler behoben werden soll.
Außerdem soll diese Rechtssprechung auch dem Schuldner dienen, der vor einem Schadenersatzanspruch eines Wohnungseigentümers auf Reparatur und eines anderen auf Herabsetzung oder "kleine" Schäden geschützt werden soll (BGH, Urteile vom 3. 4. 1998 - ZR 47/97, NJW 1998, 2967, 2968). Die Übertragbarkeit dieser Prinzipien auf Verkäufe von gebrauchten Wohnungseigentum, die ausschliesslich nach dem Kaufgesetz zu beurteilen sind, wird nicht gleichbehandelt.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf weist im Hinblick auf den dem Besteller jetzt ebenfalls zustehenden Erfüllungsanspruch diese Fragestellung zurück (OLGR 2001, 310, 312; im Wesentlichen wohl auch der KG, Urteile vom 16. 10. 2007 - 6 U 140/06, NJOZ 2008, 1590, 1597 f.) und weist darauf hin, dass der Wohnungseigentümer nur nach Maßgabe seines Miteigentumsanteils Minderungsansprüche oder "kleine" Schäden wegen Mängeln des gemeinschaftlichen Vermögens geltend machen kann.
c ) Der Gesetzesentwurf vom 24. Juli 1989 (Urteil vom 24. Juli 1989 - V ZR 40/88, BGHZ 108, 156, 158). Sie beschließt nun, dass allein aufgrund des Kaufrechts zu bemessende Minderungs- und "kleine" Schadensersatzansprüche nicht in den Geltungsbereich des 10 Abs. 6 S. 3 S. 1 WEG fielen, wenn - wie hier - eine Gebrauchtwohnung unter Ausschluß der Sachmängelhaftung veräußert wurde und keine Sachmängelhaftung übernommen wurde. aa) Gemeinschaftsrechtlich im Sinn des 10 Abs. 10 WEG.
Siehe auch BGH, Entscheidung vom 11. Mai 2007 - VII ZR 236/05, BGHZ 172, 42 Rn. 19 und über die Übernahme einer Aufgabe im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftssenat, Entscheidung vom 17. Mai 2014- V ZR 5/14, NJW 2015, 1020 Rn. 6 mwN). Diese Vollmachten können dem Eigentümer auch als Gesellschafter einer Stockwerkeigentümergemeinschaft nicht ohne weiteres gegen seinen eigenen Willen aberkannt werden.
Die Gemeinschaftsorientierung kann vor diesem Hintergrund nur bekräftigt werden, wenn die schutzwürdigen Interessen des Wohnungseigentümers oder des Gläubigers in einem gemeinsamen Rechtsstreit (BGH, Urteil vom 24. 2. 2006 - VII ZR 84/05, NJW 2006, 2254 Rn. 15) das grundlegende Primärinteresse des Berechtigten, seine Rechte selbst und in eigener Verantwortung wahrzunehmen und vor Gericht geltend zu machen, klar aufwiegen.
Im Hinblick auf die Anforderungen an die rechtliche Klarheit und die Sicherung von Rechtsgeschäften ist eine kennzeichnende Gegenleistung erforderlich (z.B. BGH, Entscheidung vom 24. Feb. 2006 - VII ZR 84/05, NJW 2006, 2254 Rn. 15 ff. siehe auch Entscheidung vom 11. 04. 2007 - VII ZR 236/05, BGHZ 172, 43 Rn. 19 mwN; A AZ Tim / Dötsch, WEG, 2.Aufl.
V ZR 125/10, NJW 2011, 1351 Rn. 9; BGH, Entscheidung vom 11. Mai 2007 - VII ZR 236/05, BGHZ 172, 42 Rn. 18 ff. Klein in Bärmann, a.a.O. Abweichend von den gemeindebezogenen Forderungen kann die Eigentümergemeinschaft diese Rechte nur geltend machen, wenn sie einvernehmlich oder mehrheitlich geklagt hat (vgl. nur Klein in Bärmann, a.a.O. 10 Rn. 251; vgl. Beschluss des Senats vom 17. Dez. 2010 - V ZR 125/10, NJW 2011, 1351 Rn. 9). bb) Nach diesen Prinzipien ist die Gemeinnützigkeit zu bestreiten.
Im Gegensatz zu Minderungsrechten und "kleinen" Schäden aus der Pflichtverletzung eines Bauherrn besteht beim Kauf von gebrauchten Wohnungen, die unter Ausschluss der Sachmängelhaftung veräußert werden, in der Regel kein Interesse des Wohnungseigentümers oder des Veräußerers, das den nach § 10 Abs. 6 S. 3 S. 1 WEG gerechtfertigten Eingriff in die private Selbstständigkeit des Erwerbers rechtfertigt.
Im Gegensatz zum Bauherrenvertrag unterliegt der Vertrag über den Kauf einer Eigentumswohnung keiner Herstellungspflicht, die auf die gleiche Dienstleistung zielt. Ankaufsverträge für Gebrauchtwohnungen werden in der Regel einzeln und mit verschiedenen Anbietern geschlossen; sie sind in der Regel zeitlich nicht miteinander verknüpft. Dies um so mehr, als die Käufer selbst, wenn mehrere Gebrauchtwohnungen von demselben Veräußerer verkauft werden, in der Regel aufgrund der allgemeinen Praxis und auch im Falle einer Formel (BGH, Entscheidung vom 06. 10. 2005 - ZR 117/04, BGHZ 164, 225, 230; vgl. auch die Entscheidung des Senats vom 6. 10. 1986 - V ZR 67/85, BGHZ 98, 100, 108 f).
und der formellen Aufnahme (Senat, Entscheidung vom 24. Juli 1989 - V ZR 40/88, BGHZ 108, 156, 162 f.) eines effektiven Ausschlusses der Haftung für Materialmängel, während in der Rechtsprechung - mit Ausnahme von recht ungewöhnlichen Ausnahmen - ein solcher Ausschluss in einem Werklieferungsvertrag nicht gilt.
Handelt es sich um den Kauf einer neuen oder noch zu bauenden Eigentumswohnung, kann die Sachmängelhaftung in der Form und im Rahmen einer Einzelvereinbarung nur unter der strikten Bedingung effektiv geregelt werden, dass der Käufer mit detaillierter Notarbelehrung über die drastischen rechtlichen Folgen beraten worden ist (BGH, Urteilsbegründung vom 27. Mai 2006).
Septembers 1987- ZR 153/86, BGHZ 101, 350, 353; BGH, Entscheidung vom 29. Jun. 1989- ZR 151/88, BGHZ 108, 164, 168; BGH, Entscheidung vom 6. Okt. 2005 - ZR 117/04, BGHZ 164, 225, 230; BGH, Entscheidung vom 08. 03. 2007- ZR 130/05, NJW-RR 2007, 895 Rn. 27).
Der Bundesgerichtshof verlangt ein gemeinsames Handeln mit der Konsequenz der Einschränkung der materielle Befugnis zur Ausübung und Einschränkung der einzelnen Strafverfolgungsbefugnisse (vgl. Urteile des BGH vom 29. 4. 1998 - ZR 47/97, NJW 1998, 2967, 2968; BGH, Urteile vom 11. 5. 1979 - Slg. 1979 - XII ZR 30/78, BGHZ 74, 258, 265).
Daraus ergibt sich, dass der Besteller Sachmängelansprüche wegen eines Mangels nach § 444 BGB - abgesehen von den Fälle einer zugesicherten Eigenschaft - nur dann erfolgreich durchsetzen kann, wenn der Auftragnehmer das Vorhandensein eines Mangels durch arglistiges Verhalten oder eine pflichtwidrige Unterlassung betrügerisch verschwiegen hat.
Daraus folgt, dass der Verein in Ermangelung böswilligen Verhaltens des Veräußerers - und damit in der Regel - durch den Abschluß von Grundstückskaufverträgen für eine Gebrauchtwohnung nicht bevorzugt wird, nur weil bereits ein Mangel an einem Recht besteht, dessen Ausübung sich erhöhen könnte. Der konstituierende Bestandteil der betrügerischen Irreführung ist personenbezogen - wenigstens unter Vorbehalt - (Senat, Entscheidung vom 7. 7. 1989 - V ZR 21/88, NJW 1990, 42 f. ; Senat, Entscheidung vom 4. 5. 1995 - V ZR 43/94, NJW 1995, 1549, 1550; Senat, Entscheidung vom 6. 4. 7. 1989).
MÄRZ 2012- V Rn. 18/11, NJW-RR 2012, 1078 Rn. 25; BGH, Entscheidung vom 19. MÄRZ 1992- III Rn. 16/90, BGHZ 117, 363, 368) - Verhaltensregeln und damit (vor)vertragliche Ehrlichkeitsanforderungen in Einzelfällen, die keinen gemeinschaftlichen Bezug haben. Abweichend von der Ansicht der Antragsgegnerin gibt es bei der Veräußerung einer Gebrauchtwohnung in der Regel kein Risiko eines Rückgriffs auf den Verkäufer, da die Kontrakte - im Unterschied zu den Akquisitionsfällen durch den Bauherrn - üblicherweise mit unterschiedlichen Anbietern abgeschlossen werden.
Doch auch wenn in Ausnahmefällen, wie hier der Fall, keine offensichtlichen Bedenken des Zahlungspflichtigen bestehen, die das Recht des Bestellers, seine Rechte auf Herabsetzung und "kleine" Schäden wahrzunehmen und vor Gericht durchzusetzen, aufwiegen. a) Dies betrifft zunächst die gleichzeitige Inanspruchnahme von Minderungs- oder Schadensersatzansprüchen durch unterschiedliche Abnehmer.
Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Werklieferungsvertragsrecht hat der einzelne Käufer Anspruch auf Schadensersatz wegen eines beseitigbaren Fehlers des Gemeinschaftseigentums in Höhe der Gesamtkosten der Mängelbeseitigung (BGH, BGH, Urteile vom 24. August 2006). Feb. 1999 - VII ZR 208/97, BGHZ 141, 63, 65; BGH, Entscheidung vom 7. Jun. 2001 - VII ZR 420/00, BGHZ 148, 85, 88; BGH, Entscheidung vom 10. 03. 2005 - VII ZR 321/03, NJW-RR 2005, 1039; Klein in Bärmann, a.a.O.
Damit ist er - wie bereits erläutert - an der Geltendmachung von "kleinen" Schadenersatzansprüchen oder Minderungsansprüchen prinzipiell ohne Ermächtigungsbeschluss der Eigentümergemeinschaft verhindert. Die vertragliche Schadenersatzforderung des Auftraggebers weicht jedoch wesentlich von der verkaufsrechtlichen Forderung ab, da sie durch die vertragliche Erfolgsverpflichtung des Auftraggebers gekennzeichnet ist (BGH, Entscheidung vom 24. Januar 1999 - VII ZR 208/97, BGHZ 141, 63, 67).
Sofern nur das Ankaufsrecht geltend gemacht wird, wird daher bei Sachmängeln des Miteigentums die gesamte Wertminderung auf die Eigentümer aufgeteilt, in der Hauptsache entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ( "Senat", Urteile vom 24. 6. 1989 - V ZR 40/88, BGHZ 108, 156, 160; Senat, Urteile vom 24. 12. 1995 - V ZR 52/95, NJW 1996, 1056, 1057; Timme/Dötsch, WEG, 2nd ed.
Dies hat sich durch die Reform des Schuldrechts nicht verändert (KG, Beschluss vom 6. Okt. 2007 - 6 U 140/06, NJOZ 2008, 1590, 1597 f. siehe auch Beschluss des Senats vom 11. April 2010 - V ZR 147/09, NZM 2010, 444, 445). Selbst wenn der Besteller die Wertminderung auf der Grundlage der zur Beseitigung des Mangels notwendigen Aufwendungen errechnet ( vgl. dazu die Entscheidung des Senats vom 21. 10. 1964 - V ZR 109/62, NJW 1965, 35 ), betrifft die so festgestellte Wertminderung jeden einzelnen Mitinhaber nur entsprechend seinem Miteigentumsanteil (Senat, Entscheidung vom 24. 6. 1989 - V ZR 40/88, BGHZ 108, 156, 160).
Seine Schädigung bemisst sich nach dem Anteil an der gesamten vorhandenen Wertminderung nach dem Anteil des Miteigentums (Senat, Entscheidung vom 22. 12. 1995 - V ZR 52/95, NJW 1996, 1056, 1057; Kommanditgesellschaft, Entscheidung vom 16. 10. 2007 - 6 U 140/06, NJOZ 2008, 1590, 1597 f.). Der Einzelschaden darf nicht höher sein als die gesamte Wertminderung des Gemeinschaftseigentums (Senat, Entscheidung vom 24. Juli 1989 - V ZR 40/88, BGHZ 108, 156, 160).
Weil sich sowohl der Minderungs- als auch der Schadensersatzanspruch nur auf die verhältnismäßigen Benachteiligungen des betreffenden Bestellers bezieht, stoßen die Forderungen weder aufeinander, noch stoßen sie im Falle eines Rücktritts oder eines Schadensersatzanspruchs anstelle der gesamten Dienstleistung aufeinander. b) Soweit der Widerspruch zwischen den Rechten auf "kleinen" Schadenersatz und Herabsetzung des Kaufpreises und dem dem dem Besteller seit der Reform des Schuldrechts gewährten Nacherfüllungsanspruch ( 439 BGB) zu keinem anderen Resultat im Sinne des 10 Abs. 6 S. 3 erster Halbsatz des WEG führen sollte.
Es kann offen sein, ob der Veräußerer einer Gebrauchtwohnung verpflichtet ist, dem Erwerber ein einwandfreies Miteigentum mit der Konsequenz einer korrespondierenden Verpflichtung zur Mängelbeseitigung über die Miteigentumsübertragung hinaus zur Verfügung zu stellen. Bei Ablehnung der Anfrage ist ein Sachleistungsanspruch von vorneherein ausgeschlossen; nur ein auf den Miteigentumsanteil begrenzter Freistellungsanspruch ( 16 Abs. 2 WEG) wird dann berücksichtigt (vgl. hierzu auch den Beschluss des Senats vom 11. 3. 2010 - V ZR 147/09, NZM 2010, 444 Rn. 11 f.).
Wird dagegen die gewünschte Beschaffenheit weiter festgestellt und dem Besteller ein "voller" (Nach-)Erfüllungsanspruch eingeräumt, so kommt die Beseitigung des Sachmangels auch solchen Abnehmern zu Gute, denen der Lieferer bereits "geringen" Schadenersatz oder Herabsetzung gezahlt hat (unter den Bedingungen, unter denen der Lieferer die Nacherfüllung nach § 439 Abs. 3 BGB, im einzelnen nach § 275/12 Slg. 2014 - V ZR 275/12, BGHZ 200, 350 Rn. 34ff. ablehnen kann).
Dies kann der arglistige Anbieter in der Regel nicht dadurch verhindern, dass er den Fehler innerhalb der allgemein geforderten Frist beseitigt, da der Auftraggeber dem arglistigen Anbieter in der Regel keine Möglichkeit dazu einräumen muss (Senat, V ZR 147/09, a.a.O. Nr. 9 mwN).
Die Tatsache, dass er - anders als die Judikatur des Bundesgerichtshofes zum Kauf vom Bauherrn - das Zahlungsunfähigkeitsrisiko des Erwerbers zu übernehmen hat, scheint angemessen, wenn man das Schutzbedürfnis des Betrügers für sehr begrenzt hält (zu letzterem ist die Entscheidung des Senats vom 27. 3. 2009 - V ZR 30/08, BGHZ 180, 205 Rn. 25; des Senats vom 24. 3. 2006 - V ZR 173/05, BGHZ 167, 19 Rn. 13).
Außerdem werden anteilige Anreicherungsansprüche gegen diejenigen Stockwerkeigentümer berücksichtigt, denen der Veräußerer die Beschaffung einer mängelfreien Sache nicht verdankt - entweder weil mit ihnen keine Vertragsbeziehungen existieren oder weil ein vereinbarter Haftungsausschluß in Kraft bleibt. Beschränkungen nach den Prinzipien der Zwangsanreicherung (vgl. nur MüKoBGB/Schwab, VII.
Dem Senatsbeschluss vom 16. Februar 2010, nach dem die Befugnisse der Eigentümer zur Abtretung von Leistungs- und Mängelbeseitigungsansprüchen gemäß 10 Abs. 6 S. 3, zweiter Halbsatz, Wohnungseigentümergemeinschaft an den Verein zur Geltendmachung nicht das Vorliegen ähnlicher Forderungen aller Eigentümer voraussetzen (vgl. V ZR 80/09, NJW 2010, 933 Rn. 8 ff.), steht das Rechtsgutachten nicht entgegen.
Daraus ist abzuleiten, dass im Hinblick auf die Forderungen des Erwerbers einer Gebrauchtwohnung auf Preisminderung oder "kleine" Schäden eine gewählte Ausübung von Befugnissen im Sinn der vorgenannten Regelung zu vermuten ist, aber hier nicht zu entscheiden ist.